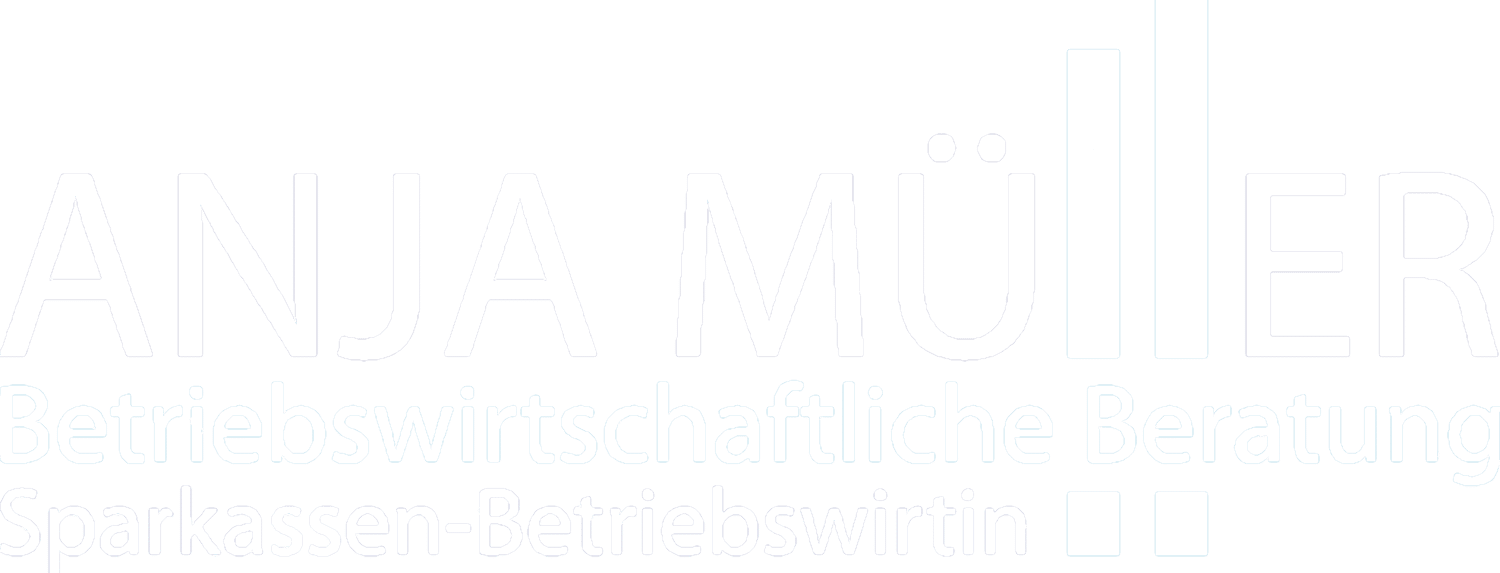Am 19. Juli 2025 haben Bundestag und Bundesrat das steuerliche Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland verabschiedet.
Dieses Programm, auch bekannt als „Wachstumschancengesetz 2.0“, soll die deutsche Wirtschaft beleben, indem es Unternehmen zu Investitionen anregt. Ziel ist es, insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu verbessern und die Modernisierung der deutschen Industrie vorantreiben.
Kernpunkte des Wachstumschancengesetz 2.0
Das Programm enthält steuerliche Anreize, die die Investitionsbereitschaft von Unternehmen fördern sollen:
Degressive Abschreibung: Für bestimmte Investitionsgüter, die ab dem 1. Januar 2026 angeschafft oder hergestellt werden, wird die Möglichkeit einer degressiven Abschreibung wieder eingeführt. Dies ermöglicht Unternehmen, in den ersten Jahren höhere Abschreibungsbeträge geltend zu machen, was die Liquidität verbessert und die Investitionskosten schneller reduziert.
Investitionsprämien: Eine Investitionsprämie für Investitionen in klimafreundliche Technologien soll Unternehmen einen direkten Zuschuss gewähren. Dies betrifft beispielsweise Anlagen zur Energieeffizienz, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität oder die Digitalisierung von Produktionsprozessen.
Verbesserte Forschungsförderung: Die steuerliche Forschungszulage wird ausgeweitet. Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung (FuE) investieren, können höhere Zuschüsse erhalten. Das soll Innovationen fördern und Deutschland als Technologiestandort stärken.
Vereinfachte Bürokratie: Das Gesetz sieht auch eine Reduzierung bürokratischer Hürden vor, die Investitionsprozesse bisher verlangsamt haben. Dazu gehören schnellere Genehmigungsverfahren und eine vereinfachte Beantragung von Fördermitteln.
Wer profitiert vom Wachstumschancengesetz?
Das Programm richtet sich an Unternehmen aller Größen, vor allem aber sollen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von den Maßnahmen profitieren. Die degressive Abschreibung und die Investitionsprämien sind so konzipiert, dass sie auch für Unternehmen mit geringeren finanziellen Rücklagen attraktiv sind. Branchen, die stark auf Innovation und Digitalisierung angewiesen sind, wie die Automobilindustrie, der Maschinenbau und die IT-Branche, dürften besonders von den neuen Regelungen profitieren.